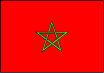
Dutzende von Tourenbeschreibungen, Tipps, Fotogalerien, Forum
| Weitere Informationen unter |
|
http://www.marokko-per-rad.de Dutzende von Tourenbeschreibungen, Tipps, Fotogalerien, Forum |
Ein Bericht von Meike
Die
Turbinen des Flugzeuges werden gestartet. Doch wo ist Thomas,
unser vierter Mann?
Beinahe
hätte unsere Reise zu Dritt begonnen, wären da nicht, 5 Minuten vor Abflug,
plötzlich noch vier rote Fahrradtaschen ins Flugzeug geladen worden und Thomas
etwas atemlos zugestiegen.
So, nun kann der Traum Wirklichkeit werden. Ich lehne mich auf dem Sitz zurück und denke daran, wie alles begann: .. auf dem Dach des Café Central in Marrakech beobachten wir nach einer dreiwöchigen Traumradtour das Treiben auf dem Djemna el Fna - Geschichtenerzähler und Gaukler wetteifern mit Verkäufern um die Gunst des Publikums. Der faszinierende Orient, der unverständliche Orient auf diesem Platz vereint - er hat uns in seinen Bann gezogen und läßt uns nicht mehr los. Der Blick schweift in die andere Richtung - schneebedeckt grüßen die Gipfel des Hohen Atlas kühl die brodelnde Stadt Marrakech. An diesem Abend haben wir es uns versprochen: „Irgendwann fahren wir nach Imilchil.“- ins Herz des Hohen Atlas. Seither hängt dieser Leitspruch bei uns in der Küche und soll erst jetzt, 2 Jahre später, umgesetzt werden. Mit von der Partie sind außer Jan und mir noch Thomas, den wir auf unserer letzten Marokkoreise kennengelernt haben und unser gemeinsamer Freund Joe.

-> zur Übersichtskarte Marokko
„Bitte
schnallen Sie sich an und stellen Sie das Rauchen ein, wir werden in Kürze
in Agadir landen.“ Nur vier Stunden sind wir von Hamburg entfernt und steigen
aus dem Flugzeug in eine andere Welt. Die Luft schlägt uns in diesem April
sommerlich warm entgegen, erfüllt von würzigen Gerüchen und fremden Stimmen,
alles irgendwie vertraut und doch wieder neu. Die Formalitäten sind schnell
erledigt, die Räder unversehrt.
Der
Flughafen liegt etwa 30 km südwestlich von Agadir entfernt. Frohen Mutes radeln
wir in der Mittagshitze auf der wohl befahrensten Straße Marokkos vom Flughafen
nach Agadir, um dort eine Fahrgelegenheit ins Inland zu bekommen. Diese Stadt lädt
uns nicht zum Verweilen ein. Das Wort Agadir bedeutet eigentlich (Getreide-) Speicher.
Das ursprüngliche Agadir ist nach einem Erdbeben 1960 völlig zerstört worden.
Die heutige Stadt ist modern und das größte Touristenzentrum Marokkos mit
vielen Hotelanlagen. Der Ort zieht die Europäer scharenweise wegen des
kilometerlangen Sandstrandes und des milden Seeklimas an. Wir wollen jedoch nur
dorthin, um eine Fahrgelegenheit nach Taliouine zu bekommen.
Doch
nun erinnern wir uns wieder vage, daß die Uhren in Afrika, auch im modernen
Agadir, anders ticken als in Hamburg. Der Bus, den wir nehmen wollten, ist
bereits ausgebucht und eine Fahrradmitnahme sei erst in 2 Tagen möglich. Auch
die Taxifahrer am zentralen Taxistand sind nicht spontan begeistert, uns ihre
Fahrdienste anzubieten. Also heißt es: abwarten und Tee trinken, den berühmt
berüchtigten Whisky Berber, Minztee mit viel Zucker, der uns aus einer
silbernen Kanne in einem meterhohen Strahl gekonnt ins Teeglas gegossen wird,
dann wird sich schon was finden - und tatsächlich, ein Taxifahrer kommt auf uns
zu, wir verhandeln einen Preis und kurze Zeit später werden wir mitsamt unserer
Räder mit 2 Taxis durch die in der Abendsonne strahlende Sousseebene nach
Taliouine gefahren.
Aber
Marokko wäre nicht Marokko, wäre diese Episode nun vorbei. Im Dunkeln, erschöpft
von diesem langen Tag, erreichen wir Taliouine, wollen zahlen, was verhandelt
war und zügig zu Bett gehen. Doch
so einfach ist das nicht: wir dürfen die Räder nicht vom Autodach nehmen und
unser Gepäck aus dem Kofferraum holen, weil der verhandelte Preis angeblich für
ein Taxi und nicht für beide sei, sprich wir sollten doppelt so viel zahlen,
wie vereinbart. In diesem Zwist gehen Taxifahrer und Mitfahrer bis zur örtlichen
Polizei, die nur herzhaft lacht und uns wieder allein läßt. Wir treffen uns
dann mit dem Preis in der Mitte, damit Frieden ist, wir unser Gepäck bekommen
und uns endlich von unseren Chauffeuren trennen können. Auf dem Campingplatz
lernen wir dann wieder die bekanntere Seite Marokkos kennen: die der
Gastfreundschaft. Obwohl es schon auf Mitternacht zugeht und der im Reiseführer
eingetragene Campingplatz ein Hotel ist, dürfen wir unser Zelt dort im Garten
aufstellen und bekommen Tee, Brot
und Orangen angeboten. Am nächsten Tag sehen wir erst, wie schön die Gegend
ist, in die wir bei dieser Nacht- und Nebelaktion gekommen sind. Unser Zelt
steht in einem paradiesischen Garten, der von einer Mauer umgeben ist, von der
aus man einen herrlichen Blick auf saftig grüne Wiesen
umrahmt von hohen Bergen im Morgenlicht werfen kann. Wir sind ca. 200 km
von Agadir entfernt im Safranland. Hier wächst die Pflanze, deren teure Fäden,
wie im bekannten Kinderlied, unseren Kuchen gel machen.
Man
mag sich fragen, was die vier Radler per Taxi im Safranland suchen, wo der Traum
doch Imilchil im Hohen Atlas ist? Ganz einfach: wir müssen uns erst einmal
einfahren und als Gruppe zusammenraufen,
ehe es ernst wird, denn Imilchil bedeutet: tagelang nur ruppige Piste ohne
berechenbare Versorgungsmöglichkeiten. Zum Einstimmen haben wir uns eine
abwechslungsreiche Strecke ausgesucht: wir wollen immer ostwärts bis zum Erg
Chebbi, dem größten Sanddünengebiet Marokkos, radeln. Für diese knapp 500 km
lange Strecke, die zu einem Teil aus Pisten besteht, haben wir eine gute Woche
Zeit eingeplant.
Von einem Café Nous-Nous, bestehend zur Hälfte aus Milch und zur Hälfte aus Nescafé, gestärkt, radeln wir den ersten Tag hinein ins Abenteuer. Die Natur meint es nicht gut mit uns, denn es geht auf rauhem, gewöhnungsbedürftigem Asphalt bei Gegenwind und brennender Sonne stetig bergan. Wir müssen uns nach dem langen deutschen Winter erst wieder an das Radeln gewöhnen zumal mit schwerem Gepäck, denn immerhin haben wir Verpflegung aus Trockennahrung für die gesamte Zeit dabei, um unabhängig von Versorgungspunkten zu sein und um Durchfallkrankheiten zu umgehen. Unsere Haut zeigt schon nach kurzer Zeit trotz Sonnenschutzfaktor 20 erste Rötungen auf. Also schützen wir jeden Zentimeter Haut mit Kopfbedeckung, langärmliger Kleidung, langen Hosen und Handschuhen. Jan hat es an der rechten Wade erwischt. Zur allgemeinen Erheiterung wickelt er sein Sitzkissen als Sonnenschutz über die versengte Haut. Auch Joes Ohr glüht interessant in der Nachmittagssonne.
 Gleich zu Beginn der Piste, die nach Agdz abzweigt, werden wir von einem Marokkaner
angesprochen, dem der Reifen geplatzt ist.
Wir helfen gern und fragen
uns, ob dies ein Zeichen sein soll, unseren ersten Pistenabschnitt vorsichtig
anzugehen. Gespannt, was uns erwartet, fahren wir weiter, schlucken immer, wenn
uns vollgepackte Fahrzeuge entgegenkommen oder überholen, jede Menge Staub auf
der holprigen Strecke. Bis wir Agdz erreichen, haben wir zwar keine Plattfüße
zu vermelden, doch ist Joe eine Vorderradtasche ausgerissen , die wir mit Bändern
an seinem Lowrider fixieren müssen. Diese Konstruktion soll noch die gesamte
Reise halten, Inch Allah!
Gleich zu Beginn der Piste, die nach Agdz abzweigt, werden wir von einem Marokkaner
angesprochen, dem der Reifen geplatzt ist.
Wir helfen gern und fragen
uns, ob dies ein Zeichen sein soll, unseren ersten Pistenabschnitt vorsichtig
anzugehen. Gespannt, was uns erwartet, fahren wir weiter, schlucken immer, wenn
uns vollgepackte Fahrzeuge entgegenkommen oder überholen, jede Menge Staub auf
der holprigen Strecke. Bis wir Agdz erreichen, haben wir zwar keine Plattfüße
zu vermelden, doch ist Joe eine Vorderradtasche ausgerissen , die wir mit Bändern
an seinem Lowrider fixieren müssen. Diese Konstruktion soll noch die gesamte
Reise halten, Inch Allah!
Der
Grund für den regen Autoverkehr auf der Piste ist das Aid El Kebir, das Große
Hammelfest .
In
der gesamten islamischen Welt ist
das Ait El Kebir wie bei uns
Weihnachten , Ostern und Pfingsten zusammen. Auf den Straßen und in den Gassen
begegnen wir festlich gekleideten nach schwerem Parfum duftenden Menschen, die
wie bunte Farbtupfen in archaischer Kulisse umhertreiben. Für mehrere
Tage steht das Öffentliche Leben still. Familien treffen sich und feiern das
Fest der Feste, für das jeder, der es sich leisten kann, einen Hammel
schlachtet. Dieser Brauch soll an die Opferung Isaaks durch Abraham erinnern.
Wir
haben uns auf unsere Weise vorbereitet, indem wir bei einem Bäcker 25 Brote
bestellen, die wir selbst aus dem Ofen ziehen dürfen. Auch ansonsten
haben wir gehamstert, was das Zeug hält. Gut eingedeckt richten wir uns
auf dem örtlichen Campingplatz ein. Dieser gehört der Berberfamilie vom Stamm
der Ait el Caid. Hassan, der zusammen mit seinem Bruder den Campingplatz
betreibt, erzählt uns , daß sein Familienclan auch die Kasbah Tamnougalte besitzt , die
im Film „ Der Himmel über der Wüste“ als Kulisse diente. Entsprechend hat
Agdz seit den Filmarbeiten einen touristischen Boom erlebt.
In früherer Zeit ist der Ort das Tor zu Schwarzafrika gewesen ist, wovon
noch heute die dunkelhäutige Bevölkerung zeugt.
Normalerweise kann man die Kasbah (Festungsburg) besichtigen, doch da
sich die ganze Familie dort zum Großen Hammelfest trifft, bleibt uns leider der
Zutritt verschlossen. 
Mit
dem Brot aus Agdz sollte Joe noch
auf der Weiterfahrt seine Bekanntschaft machen. Marokkanisches Brot ist frisch
total lecker, wird jedoch schnell zäh. Als er drei Tage altes Brot aufschneiden
will, rutscht er mit seinem Messer ab und schneidet sich mitten in den Daumen -
und fällt in Ohnmacht. Jan und Thomas sind glücklicherweise schnell zur Stelle
und versorgen ihn, indem sie die Beine hochstellen und den Daumen verbinden. Die
umherstehenden Marokkaner haben diese Szene nicht bemerkt oder einfach
ignoriert. Gut zu wissen, für den Ernstfall...
Nachdem
Joe wieder hergestellt ist, geht es weiter. Ein neues Abenteuer erwartet uns:
ein Sandsturm. Sand überall - in
der Luft, in der Kleidung, in den
Haaren, in den Ohren, in den Nasenlöchern und peitscht jeden Millimeter nackter
Haut. Davon einmal abgesehen ist das für uns ein optisches Erlebnis erster Güte:
wie Nebelschwaden fegt der Sand über die Landschaft und schleift alles glatt.
Die Natur will sich heute nicht mehr beruhigen. Im Sturm bauen wir die Zelte
auf, was sich als schwierig erweist und nachts bekommen wir kein Auge zu, weil
der Wind lautstark an der Zeltplane zerrt. Auch am kommenden Tag ebbt der Wind
nicht ab. Wir kämpfen uns erst bei Gegenwind voran und drehen dann in den Wind,
was die Geschwindigkeit von 7 km/h auf 35 km/h ansteigen läßt. Nach einem längeren
Ritt bei Rückenwind suchen wir
einen geeigneten Rastplatz. Ein Fossilienladen bietet Windschutz. Wir kauern an
der Mauer als der Eigentümer der Bude kommt, ein wettergegerbter sehniger Mann
unbestimmten Alters. Er grüßt nicht, kommt aber kurze Zeit später zu uns -mit
einer Kanne Whisky Marocain und drei Gläsern. Er läßt den Tee bei uns stehen
und geht wieder. Die marokkanische Gastfreundschaft zeigt sich immer wieder in
solch stillen Gesten. Nach dem Tee gehen wir zu ihm und schauen ihm bei seiner
Arbeit zu. Mit einem einfachen Nagel legt er eingeschlossene Fossilien filigran
aus dem Stein frei und erweckt sie damit praktisch wieder zum Leben. Eines
dieser Kunstwerke wechselt den Besitzer für einen geringen Preis und als wir
aufbrechen, schenkt er uns noch ein zweites Fossil.
 Es
gibt in Marokko nicht nur Sand und Trockenheit sondern auch unerwartet Oueds,
temporär gefüllte Flußläufe, die sich von weither auffüllen und in
trockensten Gegenden noch Straßen überspülen. Als wir das erste Mal so ein
Oued durchqueren, denken wir noch nicht daran, woher die rötliche Suppe, die über
die Straße sprudelt, wohl gekommen sein mag. Unter großem Hallo radelten wir
durch das recht tiefe, strömende Naß - abzusteigen wäre gegen unsere
Radfahrerehre gewesen. Es soll jedoch noch der Tag kommen, an dem uns das mit
der Herkunft der Oueds beschäftigen wird...
Es
gibt in Marokko nicht nur Sand und Trockenheit sondern auch unerwartet Oueds,
temporär gefüllte Flußläufe, die sich von weither auffüllen und in
trockensten Gegenden noch Straßen überspülen. Als wir das erste Mal so ein
Oued durchqueren, denken wir noch nicht daran, woher die rötliche Suppe, die über
die Straße sprudelt, wohl gekommen sein mag. Unter großem Hallo radelten wir
durch das recht tiefe, strömende Naß - abzusteigen wäre gegen unsere
Radfahrerehre gewesen. Es soll jedoch noch der Tag kommen, an dem uns das mit
der Herkunft der Oueds beschäftigen wird...
Nur
noch 40 km Piste trennen uns jetzt vom Erg Chebbi, dem ersten Ziel unserer
Reise. Wir sind in Rissani, einem expandierenden Ort mit allen Versorgungsmöglichkeiten
und rüsten für die Wüstentour auf: mit
9 Litern Wasser pro Person im Gepäck und Erkundigungen über den
Pistenverlauf starten wir am späten Vormittag in immer größer werdender Hitze
mit den besten Wünschen von neugierigen Beobachtern nach Merzouga. Gesicht, Hände
und Waden vor der Sonne schützen, letzte Materialprüfung am Bike, Halbierung
des Reifendrucks und los geht’s
über Wellblechpiste. In der flimmernden Hitze ist keine eindeutige Spur zu
erkennen, jeder Fahrer sucht sich seinen Weg. Da sich die Hammada topfeben und strauchlos in alle
Richtungen ausdehnt, ist es schwierig, die Position zu halten. Glücklicherweise
haben wir ein GPS - Navigationsgerät dabei, das uns die Suche nach dem Erg
sehr erleichtert. Auf unserer Strecke liegt ein Skelett von einem
Dromedar, das es nicht geschafft hat - nicht gerade beruhigend, wenn man
bedenkt, daß diese Tiere mehrere Tage ohne Wasser in großer Hitze und
Trockenheit leben können. Hinter
uns braut sich überflüssigerweise noch ein Sandsturm zusammen. Mit einem
flauen Gefühl im Bauch geht es mühsam auf dem Wellblech voran. Hatten die
Leute in Rissani doch recht, ist es „impossible“, unmöglich, diese Strecke
mit dem Rad zu befahren? Nein,
jetzt bitte keine Panne. Doch wieder ist es Joe, der den Schwarzen Peter gezogen
hat - Plattfuß. Nach 5 Stunden
blanken Nerven erreichen wir Merzouga unversehrt und finden den Campingplatz
unserer Wahl: wie eine Fata Morgana liegt ein von einem französischen Paar geführtes
Hotel mit angeschlossenem Campingplatz, deren Küche hochgelobt ist, vor uns.
Feierlich fahren wir durch das Tor auf den Platz. Zur Belohnung bleibt unser
Benzinkocher dann auch kalt und wir lassen uns mit einem Menü verwöhnen und
gönnen uns eine Flasche Wein aus Meknes.
Der
Erg Chebbi wird gern als Sahara für
Einsteiger bezeichnet: mit bis zu etwa 100 Meter hohen Dünen und einer Länge
von 25 Kilometern ist er das größte Sanddünengebiet Marokkos. Klar, daß wir
es uns nicht entgehen lassen, die höchste Düne zu besteigen. Nach einem
anstrengenden Aufstieg durch den feinen Sand werden wir oben mit einem
atemberaubenden Blick belohnt. Wir sehen die Hammada, über die wir geradelt
sind, blicken zurück nach Rissani und sehen Erfoud, unser nächstes Ziel, zum
Greifen nah. Auf der anderen Seite erahnen wir Algerien. Tafelberge begrenzen
die Steinwüste, Flüsse, von Palmen umsäumt,
durchschneiden wie kleine grüne Schlangen die trockene Landschaft und
wir entdecken sogar einen See - oder ist es eine Fata Morgana? Erst kurz vor
Sonnenuntergang verlassen wir schweren Herzens unseren grandiosen
Aussichtspunkt.
Der
See, den wir von der Großen Düne gesehen haben, war keine Fata Morgana. Der
Dayet Sri liegt etwa 5 km vom Erg entfernt. Er
füllt sich nur alle paar Jahre mit Wasser und ist dann ein in dieser
Landschaft surrealistisch wirkendes Reservat für Vögel, unter anderem auch für
Flamingos. Nach ausgiebigen Naturbeobachtungen am See genießen wir die letzte Wüstennacht
am Erg Chebbi bei Vollmond und
planen die Abfahrt nach Erfoud, dem Ausgangspunkt für den zweiten Teil unserer
Reise, für den kommenden Tag.
 Nach 50 km Wellblech entlang einer
Telegraphenleitung die uns die Orientierung in der Hammada dieses Mal
erleichtert, kommen wir quasi durch die Hintertür nach Erfoud. Die Zivilisation hat uns
wieder: wir radeln entlang einer Mülldeponie, dann müssen wir ein Oued, das
die Straße überspült hat und das den Frauen des Ortes kurzfristig
als Waschküche dient, überqueren. Die Stimmung der Frauen ist
ausgelassen. Anders bei uns. Nach der Stille der Wüste ist dieser Ort nicht
das, was wir erwartet haben: Immerhin ist Erfoud die Hauptstadt des Tafilalet,
des größten zusammenhängenden Oasengebietes Marokkos. Im Mittelalter war der
Ort Karawanenstützpunkt. Sklaven und Gold wurden aus Schwarzafrika nach
Marokko, Arabien und später auch nach Europa gebracht. 1917 gründeten die
Franzosen hier einen Militärstützpunkt. Uns empfängt jedoch kein Hauch von
1001 Nacht: am verlassenen Markt wird fauliges Obst und Gemüse angeboten, in
den Arkaden riecht es nach Urin, der Campingplatz ist geschlossen. Der Platz
soll völlig neu konzipiert werden und 1998 fertig sein - Inch Allah. Nachdem
wir uns vom ersten Schock erholt haben, lernen wir die andere Seite des Ortes
kennen: Bank, Hotel, Restaurants und nette, aufgeschlossene Leute. Bei einem Café
kommen wir mit Mohammed ins Gespräch. Von ihm erfahren wir, daß unser
Traumziel nicht so zu erreichen sein wird, wie wir uns das vorgestellt haben, da
es im Hohen Atlas erhebliche Niederschläge gegeben hat und dort viele Pisten
unpassierbar sind. Das Wasser fließt über die Berghänge nördlich und südlich
ab. Die Auswirkungen hier im Süden, immerhin 200 km weit vom Atlasgebirge
entfernt, sind die wasserführenden Oueds.
Nach 50 km Wellblech entlang einer
Telegraphenleitung die uns die Orientierung in der Hammada dieses Mal
erleichtert, kommen wir quasi durch die Hintertür nach Erfoud. Die Zivilisation hat uns
wieder: wir radeln entlang einer Mülldeponie, dann müssen wir ein Oued, das
die Straße überspült hat und das den Frauen des Ortes kurzfristig
als Waschküche dient, überqueren. Die Stimmung der Frauen ist
ausgelassen. Anders bei uns. Nach der Stille der Wüste ist dieser Ort nicht
das, was wir erwartet haben: Immerhin ist Erfoud die Hauptstadt des Tafilalet,
des größten zusammenhängenden Oasengebietes Marokkos. Im Mittelalter war der
Ort Karawanenstützpunkt. Sklaven und Gold wurden aus Schwarzafrika nach
Marokko, Arabien und später auch nach Europa gebracht. 1917 gründeten die
Franzosen hier einen Militärstützpunkt. Uns empfängt jedoch kein Hauch von
1001 Nacht: am verlassenen Markt wird fauliges Obst und Gemüse angeboten, in
den Arkaden riecht es nach Urin, der Campingplatz ist geschlossen. Der Platz
soll völlig neu konzipiert werden und 1998 fertig sein - Inch Allah. Nachdem
wir uns vom ersten Schock erholt haben, lernen wir die andere Seite des Ortes
kennen: Bank, Hotel, Restaurants und nette, aufgeschlossene Leute. Bei einem Café
kommen wir mit Mohammed ins Gespräch. Von ihm erfahren wir, daß unser
Traumziel nicht so zu erreichen sein wird, wie wir uns das vorgestellt haben, da
es im Hohen Atlas erhebliche Niederschläge gegeben hat und dort viele Pisten
unpassierbar sind. Das Wasser fließt über die Berghänge nördlich und südlich
ab. Die Auswirkungen hier im Süden, immerhin 200 km weit vom Atlasgebirge
entfernt, sind die wasserführenden Oueds.
Ist
unser Traum damit nicht erfüllbar? Enttäuscht hängen wir über unseren Karten
und finden nur eine Alternative: über Rich, also von Osten, in den Atlas
einzusteigen. Hierzu ist zu sagen, daß diese Route nirgendwo genauer
beschrieben ist, wir also überhaupt nicht wissen, was auf uns zukommen wird.
Doch
gesagt, getan: am folgenden Tag sitzen wir in dem Bus, der uns von Erfoud in das
gut 150 km entfernte Rich bringen soll. Die Räder und Gepäcktaschen sind auf
dem Busdach festgezurrt, wir haben jeder einen Sitzplatz ergattern können und
genießen die Fahrt durch die Oasengärten. Doch die Idylle täuscht. Tatsächlich
sind der Trockenheit mehrerer Jahre viele Palmen zum Opfer gefallen. Die Bestände
können sich, auch wenn es jetzt regnet, nicht mehr erholen, wodurch vielen
Oasenbauern die Lebensgrundlage entzogen wurde. Eine neue Geldeinnahmequelle
erhofft man sich über den Tourismus. Doch fraglich ist, ob
das ökologische Gleichgewicht erhalten werden kann, wenn Touristen trotz
Wasserknappheit aller Komfort geboten werden soll.
Die
Busfahrt ist ein Erlebnis: ein Fahrgast klatscht, der Busfahrer läßt ihn auf
freier Strecke aussteigen . Auch hält der Fahrer auf freier Strecke an, um
Leute mitzunehmen, die ihm ein Zeichen geben, anzuhalten. So reduziert
sich die Stundengeschwindigkeit auf
30-40 Kilometer. Plötzlich Lärm im vorderen Teil des Busses: es gibt
einen Streit zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast, bei dem ein Sitzplatz
aufgeschlitzt wird und die Füllung sind über den Gang ergießt. „Worum es
geht?“ Keiner kann uns das beantworten.
Mittags
steigen wir in Rich aus dem Bus. Die Schaukelei hat uns zu schaffen gemacht und
die Luft ist hier, Rich liegt erheblich höher als Erfoud, dünner und frischer,
so daß wir uns erschöpft in den Schatten eines Cafés zurückziehen und das
bunte Treiben im Ort beobachten.
Hier
werden wir von einem einheimischen Bergführer angesprochen, der Verwandte in
Imilchil hat und uns einige Tips zur Strecke geben kann. Wie sich herausstellt,
hat er jedoch die Absicht, uns vom Radl auf Schusters Rappen zu holen. Er gibt
sich wirklich alle Mühe, die Strecke als „impossible pour le bicyclette“
und „je suis guide“ , also als mit dem Rad und ohne Führung unmöglich,
erscheinen zu lassen. Als er uns nicht überzeugen kann, wünscht er uns
trotzdem viel Glück und bittet
uns, seine Verwandten zu grüßen, Inch Allah, also falls wir es schaffen
sollten.
Wir
sind nun wildentschlossen und fiebern unserem nur 150 km Luftlinie entfernten
Ziel entgegen. Die Stecke beginnt
ganz zahm. Hinter Rich öffnet sich ein weites fruchtbares Tal. Die Straße ist
zwar in schlechtem Zustand, aber immerhin sogar geteert. Zu unserer Überraschung
liegen etwas von der Straße entfernt immer wieder Orte an den Berghängen, die
auf unserer Michelin-Karte gar nicht eingezeichnet sind. Auf der Straße
begegnen uns Einheimische per Rad, Esel oder zu Fuß, die uns begeistert
zuwinken und anfeuern. Leider müssen wir aber feststellen, daß es in diesen
Orten keine offensichtlichen Versorgungsmöglichkeiten gibt. Als das Wasser zur
Neige geht, wird uns mulmig zumute. Wir bitten an verschieden Häusern um
Wasser, doch scheinbar haben die Leute selbst nur geringe Mengen vom kostbaren
Naß in Wassersäcken aus Tierhäuten gespeichert. Neun Liter pro Person kann
uns da keiner anbieten. Also müssen
wir auf eine andere Gelegenheit hoffen: als wir kaum noch daran glauben, fündig
zu werden, steht direkt neben der Straße eine Zapfstelle, an der eine Frau mit
ihrem Esel steht, die gerade ihre Wassersäcke auffüllt. Wir sind überglücklich
und füllen unsere gesamten
Wasservorräte auf. Auch wenn wir nun jeder 12 kg mehr mit uns herumschleppen
und es stetig bergauf geht, so haben wir doch erst einmal für zwei Tage
vorgesorgt. Auch einen Tag später meint es der Zufall gut mit uns, denn im
einzig eingezeichneten Ort auf der Strecke gibt es tatsächlich ein Café, in
dem wir Wasser kaufen können. Als wir den Gesamtvorrat von fünfzehn 1,5l
Flaschen aufkaufen, werden wir zwar für verrückt erklärt, aber man wünscht
uns „Bon Voyage“, Gute Reise.
 Die
Bewohner des Hohen Atlas sind Berber, die uns sehr freundlich und aufgeschlossen
begegnen. Die Frauen sind nicht verschleiert und haben im Gegensatz zu ihren
arabischen Geschlechtsgenossinnen viele Freiheiten. Zwar sind auch sie es, die auf dem Feld ackern, schwere Körbe
mit Gräsern tragen und die Herden hüten, doch strahlen sie eine Freude und ein
Selbstbewußtsein aus, das bei den Araberinnen selten zu finden ist.
Hier oben in den Bergen scheint die Zeit scheint stillzustehen. Die
Menschen leben wie schon
ihre Ahnen in einfachen Lehmhäusern, es gibt keinen Strom, kein fließendes
Wasser, die Wäsche wird im Fluß gewaschen, zu essen gibt es das, was die Natur
zu bieten hat. Geheizt wird mit Holz, das gesammelt werden muß, denn Baumbestände
gibt es hier nicht und die kargen Hänge geben kaum etwas her.
Die
Bewohner des Hohen Atlas sind Berber, die uns sehr freundlich und aufgeschlossen
begegnen. Die Frauen sind nicht verschleiert und haben im Gegensatz zu ihren
arabischen Geschlechtsgenossinnen viele Freiheiten. Zwar sind auch sie es, die auf dem Feld ackern, schwere Körbe
mit Gräsern tragen und die Herden hüten, doch strahlen sie eine Freude und ein
Selbstbewußtsein aus, das bei den Araberinnen selten zu finden ist.
Hier oben in den Bergen scheint die Zeit scheint stillzustehen. Die
Menschen leben wie schon
ihre Ahnen in einfachen Lehmhäusern, es gibt keinen Strom, kein fließendes
Wasser, die Wäsche wird im Fluß gewaschen, zu essen gibt es das, was die Natur
zu bieten hat. Geheizt wird mit Holz, das gesammelt werden muß, denn Baumbestände
gibt es hier nicht und die kargen Hänge geben kaum etwas her.
Transportmittel
sind Esel, die bis zur Belastungsgrenze beladen werden. Als wir so eine Gruppe
überholen, bricht ein Tier unter seiner Last zusammen und wird lachend
aufgerichtet. Weiter geht’s. Daß die Menschen die Gelegenheit wahrnehmen, uns
nach Zigaretten, Medikamenten (Aspirin) und Kleidung zu fragen, wundert kaum,
denn wir müssen für sie wie Wesen von einem anderen Stern sein. Doch kommt die
Frage auf, wer glücklicher sein mag? Wir mit all unserem Komfort oder sie im
Rhythmus der Natur. Zumindest sind wir glücklich, aus unserem Alltag
ausgebrochen zu sein und Bekanntschaft mit dieser Welt machen zu dürfen.
Nun,
bereits auf 2000 m Höhe, Bauverkehr. Die Straße ist inzwischen
von einer Piste abgewechselt worden, die sich immer weiter hinaufschlängelt.
Planierraupen trassieren die Piste, ein Tankfahrzeug sprengt die glatte Fläche
mit Wasser. Drumherum Berber, die ihre Felder singend mit einfachen Hacken
bearbeiten - da fragen wir uns, für wen denn diese Aktion gut sein soll,
etwa für uns Touristen?
Langsam
zehrt die Strecke an unseren Kräften, Thomas bekommt plötzlich hohes Fieber,
ich habe Durchfall. Doch wir müssen weiter. Hinter jeder Kurve gibt es etwas
Neues zu entdecken, wie zum Beispiel die Nomadenzelte dort links neben der
Strecke. Die braunen Zelte sind so gut an die Landschaft angepaßt, daß sie wie
Schatten aussehen. Erkannt haben
wir sie nur, weil die Nomaden für ihre Schafe
und Ziegen einen Steinpferch gebaut haben, in dem die Tiere über Nacht
eingesperrt sind. Als wir eine Paßhöhe erreichen, breitet sich vor uns ein
endlos weites Tal aus, in dem eine große Siedlung steht. Ist das Imilchil?
Als
wir dort ankommen, erfahren wir, daß der Ort D’Agda heißt, und daß Imilchil
noch etwa 20 km entfernt sei. Bei einem Café lernen wir Ismael kennen, der
gerade 14 Jahre Wehrdienst in der Mauretanischen Wüste hinter sich gebracht hat
und nun seine Familie in Imilchil besuchen will. Er ist eine stolze Erscheinung
mit sonnengegerbtem Gesicht, sauberer Kleidung und guter Ausrüstung. Wie er
dort hingelangen wolle? Bis hier sei er mit einem Pritschen-LKW gekommen und nun
warte er auf eine neue Mitfahrgelegenheit. Wir sind skeptisch, denn seit mehreren
Tagen haben wir keine Autos mehr gesehen, abgesehen von den Baufahrzeugen auf
der Trasse. Trotzdem wünschen ihm Bonne Route, als wir unserer treuen
Räder zum Endspurt besteigen.
Die Piste wird ruppiger. Wir müssen uns voll auf die Strecke konzentrieren, Geröll ausweichen, aufgeweichte Passagen überwinden, Furten durchqueren. Die Anspannung ist so stark, daß wir die wunderbare Natur kaum wahrnehmen: rechts die mineralienhaltigen Felswände mit ihren Grün- und Violettschattierungen, links das erste zarte Grün der Pappeln, das kräftige Grün der Gerste auf den Feldern, aufgelockert von roten Klecksen Mohn , ein Farbfeuerwerk, das rötlichen, aus Lehm erbauten Ortschaften als Kulisse dient.
 Gerade stürmt ein Berber auf
einem nervösen Araberhengst an uns vorbei, als wir einen Meilenstein entdecken,
auf dem Imilchil eingeritzt ist. Wir haben es geschafft, besetzten den Stein und
machen erst einmal eine Fotosession. Als wir aus unserer Euphorie
erwachen und uns umblicken, erscheint uns der Ort viel kleiner als erwartet. Es
gibt neben den typischen rötlichen Lehmhäusern, die zum Teil Stromversorgung
haben, ein paar Herbergen und Cafés, in denen man ein Eieromelette und Salat
bekommen kann. „Das ist jetzt genau das Richtige“, beschließen wir und
setzten uns auf die Terrasse eines Cafés . Der Patron ist der Verwandte von dem
Bergführer aus Rich. Stolz übermitteln wir
ihm seine Grüße, denn wir haben es auf unseren Rädern ohne Pannen geschafft.
Wir genießen die einfache Mahlzeit wie ein Fünfgängemenu, hatte es doch die
letzten Tage nur Tütengerichte und
altes Brot gegeben. Langsam kühlen wir aus. In über 2000 m Höhe hat die Sonne
weniger Kraft und so müssen wir uns warm anziehen, wenn wir draußen sitzen
bleiben wollen.
Gerade stürmt ein Berber auf
einem nervösen Araberhengst an uns vorbei, als wir einen Meilenstein entdecken,
auf dem Imilchil eingeritzt ist. Wir haben es geschafft, besetzten den Stein und
machen erst einmal eine Fotosession. Als wir aus unserer Euphorie
erwachen und uns umblicken, erscheint uns der Ort viel kleiner als erwartet. Es
gibt neben den typischen rötlichen Lehmhäusern, die zum Teil Stromversorgung
haben, ein paar Herbergen und Cafés, in denen man ein Eieromelette und Salat
bekommen kann. „Das ist jetzt genau das Richtige“, beschließen wir und
setzten uns auf die Terrasse eines Cafés . Der Patron ist der Verwandte von dem
Bergführer aus Rich. Stolz übermitteln wir
ihm seine Grüße, denn wir haben es auf unseren Rädern ohne Pannen geschafft.
Wir genießen die einfache Mahlzeit wie ein Fünfgängemenu, hatte es doch die
letzten Tage nur Tütengerichte und
altes Brot gegeben. Langsam kühlen wir aus. In über 2000 m Höhe hat die Sonne
weniger Kraft und so müssen wir uns warm anziehen, wenn wir draußen sitzen
bleiben wollen.
Nun
können wir uns, gestärkt und entspannt, einen Überblick verschaffen. Der Ort
hat einen zentralen Marktplatz, auf dem ein altes Tischfußballbrett steht, um
den sich eine Traube Jugendlicher versammelt hat, die sich gegenseitig beim
Spiel anfeuern. Am Rand dieses Platzes stehen abgeschlossene Blechbuden, die zum
allwöchentlichen Markt geöffnet werden.
Es
gibt einen Bäcker und Lebensmittelgeschäfte, wo wir uns mit Marmelade,
Thunfischdosen, Nudeln und
Tomatenmark eindecken, den typischen marokkanischen „Grundnahrungsmitteln“ für
uns Touristen. Die frischen Sachen kann man immer nur auf dem Wochenmarkt
ergattern. Leider, so erfahren wir, war der gerade gestern und wird erst in
einer Woche wieder stattfinden. Doch dann müssen wir schon wieder auf dem Weg
zur Küste sein, um unseren Flieger
zu bekommen. Es ist kaum
vorstellbar, daß in der Nähe von Imilchil einmal
im Jahr der berühmteste Heiratsmarkt
der Ait Hadiddou-Berber, das Moussem der Bräute, stattfindet und dann Tausende
von Menschen auf LKW-Pritschen in die Einsamkeit der Berge kommen, um
mitzufeiern. Dieser Brauch ist , wird uns erzählt, entstanden, um für die
Brauteltern Zeit und vor allem Kosten zu sparen. Statt vieler aufwendiger
einzelner Hochzeiten wird einmal im Jahr kollektiv geheiratet - sehr praktisch.
Natürlich ist dieses Ereignis auch der Tourismusbranche nicht unbekannt
geblieben. Die Berber haben sich jedoch angepaßt: durch die Verfremdung finden
Verheiratungen hier immer weniger statt, die Feier wird vielmehr ein
Spektakel, auf dem Tiere und sonstige Waren verkauft werden. Geheiratet
wird nun woanders, aber wo, daß will uns
der Patron nicht verraten.
Wir
fahren nachmittags weiter in die Bergwelt hinein. Unser Ziel ist der Lac Tislit,
der 5 km nördlich von Imilchil
liegt. Dort wollen wir ein paar Tage zelten und neue Kräfte sammeln.
Um
den Lac Tislit rankt sich eine
Legende , die gern mit dem Heiratsmarkt
in Verbindung gebracht wird. Tislit heißt Braut. Es gibt noch einen weiteren
See, den Lac Iseli , was Bräutigam heißt. Die Seen sollen durch die Tränen
eines Liebespaares entstanden sein, die nicht heiraten durften, weil ihre
Familien verfeindet waren.
Als
der Lac Tislit vor uns als eine von
mineralienhaltigen Bergen umgebene, spiegelglatte Fläche auftaucht, in der sich
die Bergwelt verdoppelt, verstehen wir, wie die Berber auf diese romantische
Geschichte gekommen sind. Ehrfürchtig radeln wir am Ufer des Sees entlang bis
zu dem Hotel du Lac, das aussieht wie eine Lehmburg und wunderschön am Ufer des
Sees gelegen ist. Wir scheinen an diesem Tag die ersten Gäste zu sein. Vor dem
Hotel sitzt ein alter Mann und repariert ein riesiges Nomadenzelt mit Nadel und
Faden. Auf der Terrasse sitzen zwei Männer und trinken Café. Dort bitten wir
um Erlaubnis, zelten zu dürfen. Gegen eine geringe Gebühr können wir es uns
gemütlich machen, wo es uns gefällt und dürfen die Sanitäranlagen des Hotels
benutzen. Nachdem wir unsere Zelte unter Pappeln aufgestellt haben, nutzen wir
nach einer Woche „radeln im eigenen Saft“, gern die warme Dusche und waschen
alles, was wir am Leib haben. Natürlich sind auch unsere Räder mal wieder fällig
für eine Wartung.
Die
Nächte hier oben auf etwa 2350
Metern sind auch Ende April noch kalt. So hat es die erste Nacht gefroren und
auch am Morgen sind trotz Sonnenscheins noch 0° C. Nebel hängt in den Bergen,
der See liegt klar vor uns, ein Hirte treibt seine Schafe zum Grasen an den See.
Um sich die Zeit zu vertreiben, spielt er Flöte. Neben uns sitzen wir zwei
Angler, die, Stunden später, von einer Frau mit Essen versorgt werden. Gestört
wird diese Idylle am Nachmittag von Motorradcrossern, die dreckverkrustet im
Pulk zum Hotel kommen. Einer von ihnen fährt mit dem Motorrad über die Treppe
auf die Terrasse. Ein anderer pinkelt in den See. Zwei weitere ziehen sich
splitternackt aus und springen ins kalte Wasser. Wie sich herausstellt, haben
diese französischen Helden die nördlich gelegene Piste bezwungen und müssen
sich erst einmal entspannen, bevor sie noch heute weiter ins Tal fahren. Wenn
man einmal das Seemannsgarn dieser tollkühnen Kerle wegstreicht, so hat sich
unsere Idee, nördlich aus dem Hohen Atlas nach Marrakech zu radeln, erledigt.
Die gesamte Strecke sei eine einzige klebrige Rutschbahn, was wir den Typen, so
wie sie aussehen, sofort abnehmen. Uns bleibt also nur die südliche Variante,
die die Oueds in der Wüste speist, was uns auch nicht gerade in Euphorie
versetzt.
Den
letzten der drei Abende verbringen wir plaudernd mit den Hotelbesitzern, die in
der Hotelhalle den Bollerofen angemacht haben. Wir erfahren einiges über die
marokkanische Bürokratie und bekommen einen Einblick in das schwierige Leben
ohne Sicherheiten, wie wir sie von zu Hause kennen.
 Schweren
Herzens trennen wir uns von dem liebgewonnenen Ort. Wir machen erste
Bekanntschaft mit einer neuen Schwierigkeit: es klingt zwar unlogisch, ist aber
so, daß das Bergauffahren auf Piste einfacher ist, als das Bergabfahren. Gerade
für mich ist es sehr schwierig, stundenlang die Bremsen auf Spannung zu halten
und dabei noch konzentriert auf alle Unebenheiten der Strecke zu reagieren. Die
Hände verkrampfen sich, der Nacken schmerzt und es geht kaum schneller voran
als bergan. So kommt das Café
Moussem nach über 20 Kilometern Anspannung gerade recht.
Schweren
Herzens trennen wir uns von dem liebgewonnenen Ort. Wir machen erste
Bekanntschaft mit einer neuen Schwierigkeit: es klingt zwar unlogisch, ist aber
so, daß das Bergauffahren auf Piste einfacher ist, als das Bergabfahren. Gerade
für mich ist es sehr schwierig, stundenlang die Bremsen auf Spannung zu halten
und dabei noch konzentriert auf alle Unebenheiten der Strecke zu reagieren. Die
Hände verkrampfen sich, der Nacken schmerzt und es geht kaum schneller voran
als bergan. So kommt das Café
Moussem nach über 20 Kilometern Anspannung gerade recht.
Bei
Sonne auf der Haut und einem warmen Café entspannen wir uns
zusehends. Um uns herum neugierige Einheimische, mit denen wir versuchen,
ins Gespräch zu kommen, um Informationen über den weiteren Streckenverlauf zu
erhalten. Leider müssen wir hier wieder einmal feststellen, daß wir diesbezüglich
von den meisten Marokkanern keine nützlichen Hinweise bekommen können. Das
Wetter ist gottgemacht und interessiert die Menschen genauso wenig wie der
Zustand irgendwelcher Pisten. Glücklicherweise begegnen uns zwei Berliner in
einem Geländefahrzeug, die uns beruhigen: die Piste sei, bis auf ein, zwei
Abschnitte, trocken und befahrbar.
Die
Landschaft in diesem Teil des Hohen Atlas ist wieder ganz anders als die entlang
der Strecke Rich-Imilchil. Die Hochebene, in der wir uns jetzt befinden, ist
beinahe vegetationslos. Die Landschaft wirkt trotzdem lebendig, denn die
mineralienhaltigen Gesteinsformationen geben eine unglaublich vielfältige
Palette an Farben her. In dieser unwirtlichen Landschaft gibt es dennoch einige
bewohnte Siedlungen. Ein in der Karte verzeichneter Marktflecken von größerer
Bedeutung ist Agoudal. Hier teilt sich die Piste in Richtung Tinerhir und
Boulmane du Dades auf. Wir werden die Piste durch das Dades-Tal wählen.
Staubig
empfängt uns der Ort. Über Häuser, Menschen, Tiere und Pflanzen hat sich
feiner Staub wie eine Patina gelegt. Als wir im einzigen, sehr ärmlichen Café
des Ortes anhalten, stehen schmuddelige Kinder mit Rotznasen neugierig um uns
herum. Der Anblick solch großer Armut tut weh und stellt unser Selbstverständnis
in Frage. „Was machen wir hier eigentlich?“ Etwas betreten essen wir unsere
Omelettes und fahren nachdenklich weiter.
Die
Piste wird ruppiger. Einige Passagen sind mit dem Auto nicht zu befahren. Wir können
mit unseren Rädern zum Glück auf Ziegenpfade oberhalb der schlechten Piste
ausweichen. Als sich der Pfad und die Piste wieder vereinigen, wird es auch für
uns schwierig. Bei einer Steigung von bis zu 15 Prozent auf sehr schlechtem, von
großen Steinen durchzogenem Untergrund müssen wir, allem Ehrgeiz zum Trotz,
immer wieder schieben. Die Kräfte schwinden genauso wie unsere Wasservorräte.
Gab es um Imilchil herum an jeder Ecke Quellwasser, so ist hier alles
staubtrocken. Als wir dann einen nach 25 Kilometern hinter Agoudal avisierten
Brunnen nicht vorfinden, stehen wir ganz schön auf dem Schlauch, denn lange
reichen die Vorräte nicht mehr. „Zur Not müssen wir die Schneereste an den Hängen
auftauen oder Wasser aus Pfützen filtern“, denken wir, als wir von weither
Motorengeräusche hören. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen deutschen
Landcruiser. Wolfgang und Jan, die auf Abenteuertour kreuz und quer durch
Marokko fahren, helfen uns gern aus der Klemme. Gemeinsam zelten wir auf einer
grünen Hochplateauwiese.
Am
späten Nachmittag kommt unerwarteter Besuch. Ein kleiner, lumpig gekleideter
Hirte mit einem sehr freundlichem und offenen Wesen setzt sich zu uns und genießt
einfach nur die menschliche Gesellschaft. Wir können uns mit ihm zwar nur in Zeichensprache verständigen,
verstehen uns aber sofort bombig. Er ist 8 Jahre alt und paßt mit seinem Hund
ganz allein auf die Herde auf. Scheinbar schläft er auch, trotz der nächtlichen
Kälte, in den Bergen. Von unseren Nachbarn bekommt er eine Tasche, die er
unbedingt haben möchte, geschenkt und verschwindet erst in den Berghängen, als
es dunkel wird. Gekrönt wird dieser Abend von einem Cognac, den Wolfgang aus
der Tiefe des Chassis hervorkramt.
Als
wir am nächsten Tag steif und klamm - es hat gefroren -
aus unseren Zelten kriechen, duftet es nach Filterkaffee. Wir würden
Wolfgang und Jan am liebsten als Begleitfahrzeug anmieten, doch haben sie leider
andere Pläne. Freundschaftlich trennen wir uns uns radeln in Richtung des höchsten
Passes, den wir je auf Pisten gefahren sind.
Auf
dem Weg begegnen wir Frauen auf Eseln, die in der traditionellen Tracht der Ait
Haddidou-Berber gekleidet sind: sie tragen schwarzweiße Wollumhänge. Ihre
spitzen Hauben zeigen uns , daß sie alle verheiratet oder geschieden sind.
Bevor sie an uns vorbeiziehen, gehen sie Jan aber noch im wörtlichen Sinne
„an die Wäsche“. Sie zerren an seinem Halstuch, als dürften sie sich
selbstverständlich bedienen. Wir sind irritiert. Die Szene war zwar nicht gefährlich
aber doch bedenklich, geben wir uns doch alle Mühe, niemanden in diesem schöne
Gastland zu verstören. Dürfen wir nicht auch den gleichen Respekt von den
Einheimischen erwarten?
 Nachdenklich
radeln wir weiter in Richtung Paßhöhe. Auf
3000 m Höhe angekommen, sind alle trüben Gedanken und körperlichen
Anstrengungen wie weggeblasen. Hunderte von Metern unter uns frißt sich der
Dades wie ein grünes Band durch Felsschluchten und hinterläßt Spuren im
Gestein, die wie Höhengrade auf einer Landkarte aussehen. Wir wollen diesen
Aussichtspunkt gar nicht mehr verlassen, doch zwingen uns die zur Neige gehenden
Vorräte voran.
Nachdenklich
radeln wir weiter in Richtung Paßhöhe. Auf
3000 m Höhe angekommen, sind alle trüben Gedanken und körperlichen
Anstrengungen wie weggeblasen. Hunderte von Metern unter uns frißt sich der
Dades wie ein grünes Band durch Felsschluchten und hinterläßt Spuren im
Gestein, die wie Höhengrade auf einer Landkarte aussehen. Wir wollen diesen
Aussichtspunkt gar nicht mehr verlassen, doch zwingen uns die zur Neige gehenden
Vorräte voran.
Bei
der Abfahrt fühlen wir uns frei wie
der Adler, der neben uns seine Kreise zieht. In dem ersten Abschnitt ist die
Piste steinfrei und sehr gut zu befahren, beinahe so glatt wie Asphalt Immer
wieder bieten sich grandiose Ausblicke auf die Schluchten unter uns. Leider
weilt dieses Glück nicht lange, bis wir uns über steinige Piste wieder in
unsere Bremsen krallen und voll auf den Boden konzentrieren müssen.
Überrascht stellen wir fest, daß diese Seite des Hohen Atlas wieder
fruchtbar ist. Wir fahren vorbei an saftigen Wiesen, auf denen
Frauen Gräser in ihre großen Flechtkörbe auf den Rücken laden, an
anderer Stelle weiden Esel, Ziegen und Schafe, immer wieder erahnen wir
Ortschaften, die an den Felswänden wie Schwalbennester kleben . Die Menschen,
denen wir hier begegnen, sind ausgelassen, grüßen, lachen und bieten uns
einmal sogar Brot an.
Am
Ende dieser Piste angekommen, müssen wir eine Furt queren. Zuerst können wir
noch fahren, doch als das Wasser dann knietief ist, müssen wir absteigen und
schieben. Johlend werden wir von einem Pulk Jugendlicher beobachtet, die
irgendwie mit ihrem Auto hierher gekommen sind und uns nun durch das Wasser
hupend verfolgen. Plötzlich, als der Motor im tiefen Wasser regelrecht absäuft,
haben wir die Lacher auf unserer Seite. Grüßend fahren wir weiter, vorbei an
in immer kürzeren Abständen aufeinanderfolgenden namenlosen Ortschaften.
Das
Wetter scheint umzuschlagen. Der Himmel ist pechschwarz und in der Ferne hören
wir ein Gewitter aufziehen. Als es dann anfängt zu regnen, bietet uns ein Mann
Unterschlupf in seiner Lagerhalle an, in dem alles vom Motor bis zum
Getreidesack herumsteht. Genauso schnell, wie der Regen begonnen hat, hört er
wieder auf, obwohl der Himmel immer noch düster ist. Der Mann meint, wir können
nun weiterfahren, es wird trocken bleiben. Wir verabschieden uns von ihm und
freuen uns, daß er Recht behalten soll.
 An diesem Abend erreichen wir die Zivilisation wieder. Der Ort heißt Msemrir,
liegt 1000 Höhenmeter unterhalb der Paßhöhe und hat alle Versorgungsmöglichkeiten,
eine Post und sogar öffentliche Telefone. Wir beziehen zur Feier des Tages ein
Hotelzimmer, duschen wieder einmal warm und gehen abends Essen. Der Patron eines
Restaurants führt uns ins Obergeschoß seines Lokals, wo wir in einem
traditionellen Salon Platz nehmen. Der Raum ist traditionell eingerichtet: es
gibt keine Stühle, dafür aber Sitzkissen, die mit Teppichen bezogen sind und
flachen Tische, auf denen das Essen serviert wird: für einen geringen Preis
bekommen wir ein ausgezeichnetes Menü, bestehend aus Tomatensalat, Couscous mit
Hammelfleisch,Orangen und Minztee. Mit vollem Magen verbringen wir die seit
Tagen erste Nacht im Bett. Welch ein Luxus!
An diesem Abend erreichen wir die Zivilisation wieder. Der Ort heißt Msemrir,
liegt 1000 Höhenmeter unterhalb der Paßhöhe und hat alle Versorgungsmöglichkeiten,
eine Post und sogar öffentliche Telefone. Wir beziehen zur Feier des Tages ein
Hotelzimmer, duschen wieder einmal warm und gehen abends Essen. Der Patron eines
Restaurants führt uns ins Obergeschoß seines Lokals, wo wir in einem
traditionellen Salon Platz nehmen. Der Raum ist traditionell eingerichtet: es
gibt keine Stühle, dafür aber Sitzkissen, die mit Teppichen bezogen sind und
flachen Tische, auf denen das Essen serviert wird: für einen geringen Preis
bekommen wir ein ausgezeichnetes Menü, bestehend aus Tomatensalat, Couscous mit
Hammelfleisch,Orangen und Minztee. Mit vollem Magen verbringen wir die seit
Tagen erste Nacht im Bett. Welch ein Luxus!
Schwerfällig
steigen wir am nächsten Morgen aufs Rad, um uns vom Dades-Tal zu verabschieden.
Die Piste ist einfach zu befahren. Es geht trotzdem nur schleppend voran. Die
letzten Tage haben uns doch sehr in Mitleidenschaft gezogen und so nehmen wir
jede Möglichkeit wahr, Pausen zu
machen.
Während
einer Kaffeepause berichtet uns der Besitzer eines kleinen Hotels , daß er auf
den Individualtourismus zählt. Viele Menschen kommen, um sich die Schlucht
anzuschauen oder auch Sport zu treiben. So hatte er im Frühjahr bereits eine
kleine Gruppe untergebracht, die auf dem Dades geraftet ist. Er will sich auf
den Tourismus einlassen und sorgt auf seine Weise vor: er hat das Hotel in
Handarbeit auf beide Flußseiten ausgebaut, ist sehr freundlich und bietet
verschiedene Wanderungen und Eselstouren in die Umgebung an. Den richtigen
Standort, nämlich die wildromatische Umgebung mit der engen Schlucht und den
noch sehr ursprünglich wirkenden Berberdörfern, hat er sich jedenfalls gut
ausgesucht. Als wir ihn verlassen und weiter ins Tal rollen, sehen wir, daß er
nicht der einzige ist, der ein Stück vom Touristenkuchen abbekommen möchte. An
der Straße stehen noch gut verteilt, aber schon in kurzen Abständen
aufeinanderfolgend, Teppichläden neben Restaurants und Hotels.
Inzwischen
haben wir wieder Asphalt unter den Rädern und können uns voll auf die Umgebung
konzentrieren. Dieser letzte Abschnitt des Dades-Tals bietet landschaftlich fast
alles, was wir bislang in der Einsamkeit genossen haben: Einblicke in spektakuläre
Schluchten wechseln sich mit atemberaubenden Felsformationen ab. Links von uns
sehen wir rötliche Felsfinger, die wie eine wogende Affenhorde
aus dem Boden ragen. Daneben, umgeben von lichtgrünen Pappeln, ein gut
erhaltener Kasbahkomplex. Diese Burgen sind typisch für die Architektur der
Berber und dienten Stämmen oder ganzen Dörfern als Zufluchtsort bei Angriffen
feindlicher Stämme.
Als
wir dann in einen größeren Ort kommen, trauen wir unseren Augen kaum.
Ungewohnt viele Touristen scharen sich hier um Cafés und Souvenirläden. Bei
Sonnenschein sitzen wir auf der Terrasse eines Cafés und lassen die Reise vor
der großartigen Bergkulisse Revue passieren. Um uns herum westeuropäischer
Trubel, bekannte Geräusche. Als
wir von einer deutschen Reisegruppe, die hierher mit dem Bus einen Tagesausflug
macht, angesprochen werden : „Sind Sie mit einer organisierten Radgruppe
hier?“ denken wir, mit Blick auf die Berge: „Irgendwann fahren wir nach
Imilchil...“

| Radreisen | Radsport |